News

Das Lieferkettengesetz (LkSG) ist ein bedeutendes Regelwerk, das die Verantwortung deutscher Unternehmen für menschenrechtliche und umweltbezogene Standards entlang ihrer globalen Lieferketten festlegt. Für den Mittelstand und die Rechtsabteilungen ist es essenziell, die aktuellen Entwicklungen in Deutschland und Europa im Blick zu behalten, da Änderungen in der Gesetzgebung signifikante Anpassungen in der operativen Praxis nach sich ziehen können. Besonders die jüngsten Entscheidungen der Europäischen Union (EU) im November 2025 haben das regulatorische Umfeld stark beeinflusst.
Hier die wichtigsten Punkte zum Lieferkettengesetz (LkSG):
-
EU-Lieferkettengesetz wird deutlich abgeschwächt
-
Schwellenwerte für Unternehmen steigen stark
-
Haftung wird europaweit eingeschränkt
-
Berichtspflichten werden reduziert
-
Verantwortlichkeiten konzentrieren sich auf Hochrisikolieferanten
-
Nationale Umsetzung bleibt entscheidend
Das aktualisierte EU-Regelwerk – Lieferkettengesetz (LkSG) Stand November 2025
Im November 2025 hat das EU-Parlament eine entscheidende Weichenstellung vorgenommen, die den Rahmen für unternehmerische Sorgfaltspflichten deutlich erkennbar verändert:
1. Lockerung der Berichtspflichten und Geltungsbereich
-
Das ursprünglich geplante EU-Lieferkettengesetz, das für große Unternehmen mit mehr als 1000 Beschäftigten und mindestens 450 Millionen Euro Jahresumsatz gelten sollte, wurde auf mindestens 5000 Beschäftigte und 1,5 Milliarden Euro Umsatz angehoben.
-
Die Regelung konzentriert sich nun auf die besonders risikobehafteten Lieferantenstufen, statt die gesamte Lieferkette umfassend zu kontrollieren. Unternehmen sind nur noch verpflichtet, bei besonders hohen Risiken zu handeln.
2. Verantwortlichkeiten und Haftung
-
Die europaweite Haftung für Verstöße gegen Umwelt- und Menschenrechtsstandards wird gestrichen. Die Entschädigung von Opfern hängt künftig von nationalen Gerichten ab, was eine erhebliche Schwächung der Durchsetzungskraft bedeutet.
-
Für mittelständische Unternehmen bedeutet dies eine deutlich geringere Gefahr von Haftungsrisiken, allerdings auch eine eingeschränkte Kontrolle über die gesamte Lieferkette.
3. Auswahl und Schwellenwerte
-
Die Schwellenwerte für die verpflichteten Unternehmen steigen deutlich. Dies bedeutet, dass viele kleinere und mittlere Unternehmen (KMU) weiterhin von der direkten Gesetzesbindung ausgenommen bleiben, was eine differenzierte Risikoanalyse notwendig macht.
4. Kritik und Kontroversen
-
NGOs wie Misereor kritisierten die Entscheidung als „Desaster für Menschenrechte“, während Wirtschaftskreise die Anpassung als notwendige Erleichterung für den Mittelstand sehen.
-
Kritiker befürchten, dass die angestrebte europäische Harmonisierung die nationale Verantwortung schwächt und die Kontrolle der Lieferketten erschwert.
Arbeitgeberpräsident Dr. Rainer Dulger und Handwerkspräsident Jörg Dittrich haben deshalb bereits 2023 einen alarmierenden Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) geschrieben, über den unter anderem die „Deutsche Handwerkszeitung“ berichtet.
„Die Politik muss hier die Grenzen des tatsächlich Leistbaren erkennen und respektieren“, schreiben sie an Scholz und appellieren an ihn, sich für grundlegende Änderungen der EU-Richtlinienentwürfe einzusetzen. „Weitere Belastungen können den Betrieben nicht zugemutet werden“, warnen sie in dem Brief. Dittrich vertritt mit dem „Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH)“ eine Million Mittelständler. Die Arbeitgeber-Bundesvereinigung BDA vertritt Betriebe aller Branchen als Sozialpartner-Spitzenverband.
Warum das Lieferkettengesetz (LkSG) heute wichtig ist
-
Das Lieferkettengesetz (LkSG) zielt darauf ab, Menschenrechte und Umweltstandards entlang globaler Lieferketten wirksam zu schützen. Es verpflichtet Unternehmen, Risiken in ihrer Wertschöpfung zu identifizieren, zu bewerten und entsprechende Abhilfemaßnahmen zu ergreifen. Parallel dazu wächst der regulatorische Druck in der EU (CSDDD) und international, wodurch Unternehmen strategisch handeln müssen, um Compliance-Risiken zu minimieren. Leserinnen und Leser erhalten hier eine kompakte, praxisnahe Orientierung zu Pflichten, Umsetzungswegen und Folgen bei Nicht-Compliance.
Rechtsrahmen: Nationales Lieferkettengesetz (LkSG) vs EU-Ansätze
-
Nationales LkSG: Seit dem 1. Januar 2023 gilt das Gesetz in Deutschland und richtet sich primär an Unternehmen mit über 1.000 Beschäftigten; es verlangt Risikoerkennung, Grundsatzerklärung, Beschwerdekanäle, Abhilfe und Berichterstattung. Ab 2024/2025 erstreckt sich die Verpflichtung auf die gesamte Lieferkette und führt zu potenziellen Bußgeldern bei Verstößen.
-
EU-Regelungen: Die EU hat das umfassende Lieferkettengesetz (EU-Lk) und weitere Regelungen (CSDDD) beschlossen bzw. vorangetrieben, um eine harmonisierte Sorgfaltspflicht in der gesamten EU zu etablieren. Große Unternehmen mit umfangreichen Lieferketten müssen sicherstellen, dass Menschenrechts- und Umweltstandards sowohl innerhalb Europas als auch bei unmittelbaren und mittelbaren Zulieferern eingehalten werden. Die konkrete Umsetzung variiert, doch der Trend geht zu strengeren Dokumentations- und Berichtspflichten sowie strengeren Durchsetzungsmaßnahmen.
Pflichten der Unternehmen: Was genau muss umgesetzt werden?
-
Risikomanagement: Einrichtung eines systemsatischen Risikomanagements zur Ermittlung, Bewertung und Priorisierung von Risiken in der Lieferkette.
-
Grundsatzerklärung: Veröffentlichung einer Grundsatzerklärung, die Verpflichtungen, Ziele und anschlussfähige Maßnahmen beschreibt.
-
Abhilfemaßnahmen: Ergreifen von Korrektur- und Abhilfemaßnahmen bei identifizierten Verstößen, insbesondere gegen Menschenrechte und Umweltstandards.
-
Beschwerdekanäle: Einrichten von internen und externen Beschwerdemöglichkeiten für betroffene Personen in der Lieferkette.
-
Dokumentation und Berichterstattung: Nachweisführung der Maßnahmen und regelmäßige Berichterstattung über Fortschritte; Verzahnung mit anderen Regelwerken wie CSRD ist relevant.
-
Anwendungsbereich: Der Geltungsbereich umfasst die direkten Lieferanten (und durch EU-Ansätze auch mittelbare Zulieferer), mit wachsamen Übergang zu einer umfassenderen Lieferkette in späteren Umsetzungsphasen.
Umsetzungspraxis: Praktische Schritte und Tools
-
Risikoanalyse: Systemeinsatz zur Erfassung von Risiken in Beschaffung, Produktion, Arbeitsbedingungen, Umweltaspekten und Korruptionsrisiken.
-
Grundsatz- und Maßnahmenkatalog: Erstellung einer Grundsatzerklärung, inkl. geplanter Abhilfemaßnahmen und Zeitplänen.
-
Beschwerdemechanismen: Mehrkanal-Systeme (Webformulare, Hotline, externe Ombudsstelle) mit zeitnaher Bearbeitung.
-
Lieferkettendokumentation: Erstellung von Berichten, Auditplänen und Fortschrittsberichten; Verknüpfung mit CSR- bzw. ESG-Berichtspflichten.
-
KI-Unterstützung: Einsatz von KI-gestützten Analysen zur Risikoidentifikation, Mustererkennung in Lieferketten, Dokumentationsautomatisierung und Benchmarking.
Praxisbeispiele: konkrete Fallstudien aus unterschiedlich großen Unternehmen
-
Fallstudie 1 – DAX-Unternehmen (groß): Ein weltweit tätiges Industrieunternehmen implementiert ein mehrstufiges Risikomanagement, aktualisiert Verträge mit Lieferanten, etabliert einen mehrsprachigen Beschwerdekanal und verknüpft Berichterstattung mit CSRD-Reporting. Ergebnisse: verbesserte Transparenz entlang der Lieferkette, reduzierte Vorwürfe von Compliance-Verstößen, klarere Ausrichtung von Auditplänen. Zentrale Erkenntnisse: frühzeitige Einbindung von Lieferanten, klare KPI-Definitionen, regelmäßige Schulungen. [Quelle: Branchenberichte, Unternehmensberichte]
-
Fallstudie 2 – Mittelständisches Unternehmen (B2B/B2C): Ein mittelständischer Textilzulieferer implementiert eine Grundsatzerklärung, führt regelmäßige Risikoanalysen in regionalen Beschaffungsnetzwerken durch, etabliert Beschwerdewege und koordiniert Abhilfemaßnahmen mit größeren Kunden. Ergebnisse: bessere Lieferantenentwicklung, geringere Störungsraten in der Produktion, stärkere langfristige Partnerschaften. Erkenntnisse: pragmatische Umsetzung mit Fokus auf Priorisierung von Hochrisikobereichen. [Quelle: CSR-Studien, Branchenreports]
-
Fallstudie 3 – Einzelhandel mit globalen Lieferketten: Ein Handelsunternehmen legt besonderen Fokus auf Transparenz bei direkten und indirekten Zulieferern, setzt Audits in Kernländern durch, nutzt KI-gestützte Analysen zur Risikoerkennung und integriert Lieferkettendaten in CSR-Berichte. Ergebnisse: verbesserte Compliance-Reichweite, schnellere Reaktion bei Abhilfemaßnahmen, Stärkung des Stakeholder-Trust. Erkenntnisse: Harmonisierung von Beschaffungs- und Berichterstattungsprozessen ist zentral. [Quelle: Branchenstudien, Unternehmenskommunikation]
Durchsetzung, Sanktionen und Folgen des Lieferkettengesetz (LkSG)
-
Bußgelder: Verstöße gegen LkSG können je nach Schweregrad mit hohen Bußgeldern belegt werden; Ausschluss von öffentlichen Aufträgen ist möglich.
-
Berichtspflichten: In der EU- und nationalen Praxis können Berichts- und Offenlegungspflichten angepasst oder reduziert werden; zuletzt gab es Hinweise auf mögliche Änderungen in der Berichtspflicht. Eine klare, aktuelle Rechtslage ist wichtig, da politische Entscheidungen regelmäßig angepasst werden.
Branchenspezifische Perspektiven
-
Industrie und Produktion: Komplexe Lieferketten mit vielen Stufen; Fokus auf Rohstoffe, Lebenszyklusanalysen und Abhilfemaßnahmen in Hochrisikosektoren.
-
Textil- und Bekleidungsindustrie: Hohe Relevanz von faire Arbeitsbedingungen, Löhnen und Arbeitszeiten in naheliegenden Zulieferbetrieben; häufige Audits und Zertifizierungen als Instrumente.
-
Elektronik und IT-Komponenten: Lieferketten mit komplexen Reparatur- und Recyclingprozessen, seltenen Erden; Anforderungen an Transparenz und verantwortungsvolle Beschaffung.
-
Handel und Einzelhandel: Großteil der Beschaffung aus globalen Märkten; Beschwerdemechanismen und Transparenzberichte oft zentrale Anforderungen.
Transparenz, ESG und Investorenperspektive
-
Schnittstelle zu CSRD: Die EU-Taxonomie- und CSRD-Berichtspflichten ergänzen LkSG-Anforderungen; Unternehmen sollten Synergien nutzen, um Berichte konsistent und effizient zu erstellen.
-
Investorenfokus: Lieferkettenrisiken beeinflussen ESG-Scores, Kreditkonditionen und Zugang zu Kapital; Transparenz über Risikofaktoren und Abhilfemaßnahmen wird zunehmend erwartet.
-
Berichterstattung: Offene Kommunikation über Risiken, Maßnahmen, Fortschritte und Abhilfe ist Schlüssel für Vertrauen von Stakeholdern.
Kritik, offene Fragen und Ausblick
-
Mittelbare Zulieferer: Diskussionen darüber, wie stark mittelbare Zulieferer in die Sorgfaltspflichten eingebunden werden sollen; politische Debatten beeinflussen die Ausweitung der Pflichten.
-
Regierungspolitik: Berichte über Änderungen im Berichts- und Durchsetzungsrahmen können entstehen; hier ist Aktualität entscheidend, um Fehlinterpretationen zu vermeiden.
Lieferkettengesetz (LkSG) – Checkliste für Unternehmen (2025/2026)
-
Checkliste: Schritt-für-Schritt-Umsetzung 2025/2026
-
Governance und Verantwortlichkeiten festlegen: Klare Rollenverteilung, Zuweisung eines Data-Driven-Owners für Lieferkettendaten.
-
Risikomanagement implementieren: Risikoidentifikation, -bewertung, Priorisierung, regelmäßige Aktualisierung.
-
Grundsatzerklärung erstellen: Ziele, Verpflichtungen, Zeitpläne, interne Verantwortlichkeiten.
-
Beschwerdekanäle etablieren: Mehrkanalzugang, Datenschutz sicherstellen, klare Bearbeitungsfristen.
-
Abhilfemaßnahmen definieren: Korrekturmaßnahmen, Zeitpläne, Wiederherstellungspotenziale.
-
Lieferantenmanagement stärken: Schulungen, Governance-Meetings, Audits, vertragliche Verankerung von Sorgfaltspflichten.
-
Berichterstattung integrieren: Fortschrittsberichte, CSRD-/ESG-Verknüpfung, Auditberichte.
-
Monitoring, Audits und Kontrollen: Interne Kontrollen, unabhängige Audits, Korrekturmaßnahmen nach Prüfungen.
-
EU-/Nationale Rechtslage beobachten: Trends verfolgen, Anpassungen zeitnah implementieren. [Praxisleitfäden, Branchenberichte]
-
Lieferkettengesetz (LkSG) – die Relevanz für den Mittelstand und die Rechtsabteilungen
1. Pflichten und Umsetzung
-
Mittelständische Unternehmen sollten ihre Lieferketten gezielt auf Hochrisikobereiche prüfen. Die Konzentration auf einzelne „Risikolieferanten“ erfordert eine gezielte Risikoanalyse.
-
Die Überprüfung von Beschwerdewegen, Dokumentationsprozessen und Abhilfestrategien bleibt essenziell, um im Falle von Nachprüfungen nachzuweisen, dass die gesetzlichen Anforderungen eingehalten wurden.
2. Konkrete Maßnahmen
-
Risikoanalyse aktualisieren: Fokus auf Hochrisikobereiche, einzelne Lieferanten priorisieren.
-
Verantwortlichkeiten klären: Intern Verantwortliche für Lieferkettentransparenz bestimmen.
-
Berichte anpassen: Dokumentation und Berichte nur noch für relevante Lieferanten erstellen.
-
Rechtliche Beratung: Überprüfung der Auswirkungen der EU-Änderungen und Anpassung der Compliance-Strategie.
3. Strategische Überlegungen
-
Die Lockerungen bedeuten, dass mittelständische Unternehmen die Einhaltung der Standards gezielter steuern können, jedoch den Anspruch an Transparenz und Sorgfalt nicht vernachlässigen dürfen.
-
Die zunehmende Bedeutung von KI-gestützten Tools zur Risikoerkennung und Dokumentation bietet dabei Chancen, um Effizienz und Wirksamkeit zu steigern.
Der aktuelle Ausblick zum Lieferkettengesetz (LkSG)
Die aktuellen EU-Entscheidungen vom November 2025 führen zu einer deutlichen Abschwächung der ursprünglichen Sorgfaltspflichten, insbesondere für kleinere und mittlere Unternehmen. Während die Reduzierung der Berichtspflichten den bürokratischen Aufwand verringert, bleibt die Herausforderung bestehen, nachhaltige und menschenrechtskonforme Lieferketten proaktiv zu steuern. Unternehmen und Rechtsabteilungen sollten ihre Compliance-Strategien anpassen, individuelle Risiken bewerten und KI-Technologien nutzen, um den gesetzlichen Anforderungen auch unter den neuen Rahmenbedingungen gerecht zu werden.
Nächste Schritte für Unternehmen
-
Überwachung der EU-Rechtsentwicklungen
-
Aktualisierung interner Compliance-Prozesse
-
Schulung der Mitarbeitenden
-
Nutzung digitaler Tools für Risikoanalyse und Dokumentation
Seit 2024 gilt das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) für Unternehmen mit mindestens 1.000 Mitarbeitenden und Sitz oder Zweigniederlassung in Deutschland. Die aktuellen EU-Änderungen heben die Schwellenwerte für direkt verpflichtete Unternehmen nochmals deutlich an. Mittelständler sind meist weiterhin nicht direkt betroffen, können aber durch Anforderungen ihrer Großkunden in der Lieferkette indirekt einbezogen werden.
Mit dem Reformpaket von 2025 entfällt die jährliche öffentliche Berichtspflicht rückwirkend ab 2023. Unternehmen müssen keine Berichte mehr bei der BAFA einreichen, aber die interne Dokumentationspflicht bleibt bestehen. Die Dokumentation dient weiterhin als Nachweis im Prüfungsfall und Grundlage für Kundenanfragen oder Audits.
Unternehmen sind verpflichtet, weiterhin Risikomanagementsysteme vorzuhalten, Risikoanalysen durchzuführen, Präventions- und Abhilfemaßnahmen zu definieren und eine Grundsatzerklärung zu Menschenrechten und Umwelt abzugeben. Die fortlaufende, interne Dokumentation all dieser Maßnahmen bleibt eine Kernanforderung, auch ohne die verpflichtende Veröffentlichung nach außen.
Bußgelder werden nur noch bei schwerwiegenden Verstößen (z. B. keine Präventions- oder Abhilfemaßnahmen, fehlender Beschwerdemechanismus) verhängt, ihre Höhe kann bei großen Unternehmen bis zu 2% des Jahresumsatzes ausmachen. Die BAFA prüft künftig anlassbezogen und kontrolliert die interne Dokumentation, öffentliche Berichte müssen nicht mehr erstellt werden.
Quellen
-
Zeit.de: Europäische Union: EU-Parlament stimmt für Lockerung des Lieferkettengesetzes, 2025
-
Handelsblatt: EU-Parlament stimmt für Lockerung des Lieferkettengesetzes, 2025
-
Vatican News: Hilfswerk sieht in EU-Entscheidung „Desaster für Menschenrechte“, 2025
-
Deutsche Telekom: Auswirkungen der EU-Entscheidung auf mittelständische Unternehmen, 2025
-
Misereor: Kritik an EU-Kürzungen, 2025
Externe Quellenliste
-
Bundesregierung/ BMZ: Offizielle Hinweise zur Umsetzung und anstehenden Anpassungen im LkSG; Zitate zu Pflichten, Berichtspflichten und Harmonisierung. [ Quelle: BMZ-Website, LkSG-Besprechungen ]
-
BAFA/ BMAS: Hinweise zu praktischen Umsetzungsschritten, Anwendungsbeispielen und Meldemechanismen. [ Quelle: BAFA-BMAS Hinweise ]
-
Tagesschau/Tagesschau.de: Bilanz und Praxisbewertung nach dem ersten Umsetzungsjahr; Zitat zur aktuellen Durchsetzungsreife. [Tagesschau: Bilanz nach einem Jahr]
-
DAX-Unternehmen Fallberichte: Audits, Lieferantenschnittstellen, Abhilfemaßnahmen und Transparenzberichte; Zitate aus Unternehmensdokumentationen.
-
Misereor und CSR-Reports: Perspektiven aus NGOs und Praxisberichten zu menschenrechtlichen Auswirkungen. [Misereor], [CSR-in-Deutschland]
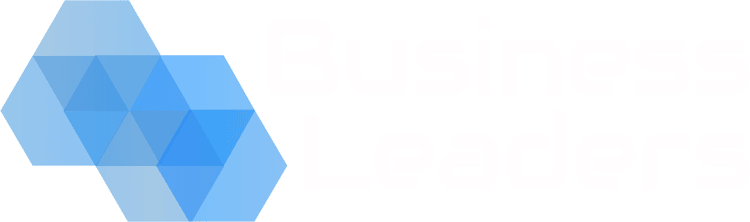
















Noch kein Kommentar vorhanden.