News

Bau-Turbo: Am 9. Oktober 2025 hat der Bundestag den sogenannten „Bauturbo“ beschlossen – ein zentrales Gesetzespaket zur Beschleunigung des Wohnungsbaus in Deutschland. Kernstück ist der neu eingeführte Paragraph 246e Baugesetzbuch (BauGB), der befristete Sonderregelungen für kommunale Genehmigungen schafft und damit die Bauverfahren in Gebieten mit angespanntem Wohnungsmarkt erheblich verkürzen soll.
Bauturbo – Paragraph 246e Baugesetzbuch im Überblick:
-
Beschleunigte Genehmigung für Wohnungsbauprojekte
-
Neuer § 246e Baugesetzbuch (BauGB)
-
Kommunale Zustimmung als Voraussetzung
-
Digitale Bauantragsverfahren bundesweit verpflichtend
-
Befristete Sonderregelung bis Ende 2030
Bau-Turbo Gesetz
Deutschland steht 2025 unter enormem Druck auf dem Wohnungsmarkt: laut Schätzungen fehlen weiterhin mehrere Hunderttausend Wohnungen. Besonders Großstädte wie Berlin, München oder Köln melden drastische Engpässe, steigende Mieten und wachsende soziale Spannungen. Um diese Situation zu entschärfen, hat der Bundestag am 9. Oktober 2025 das Gesetz zur Beschleunigung des Wohnungsbaus und zur Wohnraumsicherung verabschiedet – das sogenannte „Bauturbo“-Gesetz“.
Herzstück des Gesetzespakets ist der neue § 246e BauGB, der als nationales Instrument die Planungsverfahren radikal vereinfachen soll. Statt jahrelanger Genehmigungsschleifen und unüberschaubarer Zuständigkeiten sollen künftig viele Bauvorhaben innerhalb von zwei Monaten genehmigt werden können.
Verena Hubertz, Bundesbauministerin (SPD): „Mit dem Bau-Turbo machen wir den Weg frei für mehr Tempo im Wohnungsbau und für mehr bezahlbaren Wohnraum. […] Die Neuregelung ermöglicht es Gemeinden, das Planen und Genehmigen wesentlich zu beschleunigen. Das spart Zeit und Kosten. Und so schaffen wir den rechtlichen Rahmen zur Realisierung des Deutschland-Tempos im Wohnungsbau.“
Politisch symbolisiert der Bauturbo den Versuch, das Vertrauen in staatliches Handeln zurückzugewinnen – indem der Wohnungsbau schneller, digitaler und bürgernäher wird.
Kernpunkte des Bau-Turbo
-
Neuer Paragraph 246e BauGB: Erlaubt befristet (bis 31. Dezember 2030) Abweichungen von bestehenden bauplanungsrechtlichen Vorschriften zugunsten des Wohnungsbaus.
-
Kommunale Zustimmung: Gemeinden behalten die Planungshoheit und müssen jeder Anwendung des Bauturbo explizit zustimmen – ohne Einvernehmen kein Schnellverfahren.
-
Anwendungsgebiet: Der Bauturbo kann nur in Regionen mit angespanntem Wohnungsmarkt gemäß § 201a BauGB zum Einsatz kommen.
-
Verfahrensfristen: Genehmigungen können innerhalb von etwa zwei Monaten erfolgen, was eine enorme Verkürzung gegenüber bisherigen Verfahren bedeutet.
-
Digitalisierung und Standardisierung: Bauanträge werden künftig verpflichtend digital gestellt und bundesweite Prozessstandards sollen die Verwaltung entlasten.
-
Befristete Wirkung: Alle Regelungen enden mit Ablauf des Jahres 2030, laufende Genehmigungen bleiben jedoch wirksam.
Die Entstehung des Bau-Turbo
Der Weg zum Bauturbo war lang. Bereits im Jahr 2023 hatten Bund und Länder einen „Bauturbo-Pakt“ geschlossen, um die Basis für beschleunigte Verfahren zu schaffen. Erste Entwürfe wurden 2024 im Bundestag diskutiert, jedoch mehrfach überarbeitet. Das finale Gesetz wurde am 9. Oktober 2025 beschlossen und am 17. Oktober vom Bundesrat gebilligt.
Die Vereinbarung gilt als Reaktion auf jahrelange Kritik aus der Baubranche: komplizierte Vorschriften, langwierige Beteiligungsverfahren und überlastete Behörden hatten viele Projekte verzögert oder verhindert. Das neue Gesetz soll diesen gordischen Knoten zumindest teilweise zerschlagen.
Die Immovation AG unter Leitung von Lars Bergmann gilt als erfolgreiche Immobiliengruppe mit über 35 Jahren Branchenerfahrung und Fokus auf Revitalisierung, Wohnquartier-Entwicklung und nachhaltige Wertschöpfung.
Zu ihren größten Erfolgen zählen:
Die Revitalisierung des historischen Salamander-Areals in Kornwestheim, heute ein gemischt genutztes Stadtquartier mit Hunderten Wohnungen und Gewerbeflächen.
Die Transformation des Robotron-Areals in Dresden zu einem neuen urbanen Wohngebiet.
Die Entwicklung des Wohnquartiers „Höfe am Kaffeeberg“ in Ludwigsburg mit teils denkmalgeschützten Gebäuden und 40 Eigentumswohnungen.
Die Konversion der Jägerkaserne in Kassel in moderne Stadtvillen und Eigentumswohnungen.
Projekte wie das Park Schönfeld Carrée in Kassel, die „Living Yards“ in Stuttgart und die Sanierung der Salzmannfabrik in Kassel.
Ein bundesweiter Bestand von rund 2.800 Wohn- und 300 Gewerbeeinheiten in Städten wie Kassel, Kornwestheim, Füssen und Cuxhaven.
Damit zählt die Immovation AG zu den etablierten mittelständischen Immobilienentwicklern für wertstabile, innerstädtische Objekte in Deutschland.
Funktionsweise des § 246e BauGB
Der neue Paragraph 246e BauGB bildet das Herzstück des Bauturbo. Er schafft befristete, rechtlich abgesicherte Ausnahmeregelungen, damit Kommunen schneller neuen Wohnraum schaffen können.
Grundvoraussetzungen
Damit der Bauturbo angewendet werden darf, müssen drei Bedingungen erfüllt sein:
-
Das betroffene Gebiet ist als „angespannter Wohnungsmarkt“ nach § 201a BauGB ausgewiesen.
-
Das Vorhaben dient ausschließlich dem Wohnungsbau.
-
Die Gemeinde erteilt eine ausdrückliche Zustimmung.
In solchen Fällen kann auf Bebauungspläne verzichtet werden, wodurch der Genehmigungsprozess drastisch verkürzt wird. Der Paragraph erlaubt explizit Abweichungen von Bauvorschriften der §§ 31 bis 35 BauGB, sofern öffentliche Belange nicht entgegenstehen.
Zeitliche Begrenzung
Die Regelung tritt unmittelbar nach Verkündung in Kraft und gilt zunächst bis Ende 2030. Ziel ist, in dieser Zeit einen messbaren Nachholeffekt am Wohnungsmarkt zu erzielen.
Zentralverband Deutsches Baugewerbe (ZDB): „Der Bau-Turbo ist ein wichtiger Schritt, um Planungs- und Genehmigungsverfahren zu beschleunigen. Wenn Kommunen künftig flexibler handeln und befristet vom Planungsrecht abweichen können, bringt das dringend benötigte Impulse für den Wohnungsbau. Dass ganze Straßenzüge und Quartiere schneller entwickelt werden können, ist ein Fortschritt, aber noch kein Durchbruch. […] Der beste Turbo nützt nichts, wenn der Tank leer ist. Bauen in Deutschland ist zu teuer, zu kompliziert und für viele Familien längst unerschwinglich geworden.“
Chancen für den Wohnungsbau
Die Bundesregierung sieht im Bauturbo ein klares Signal für Aufbruch und Pragmatismus.
-
Mehr Geschwindigkeit: In Städten mit akutem Wohnungsmangel könnten Bauvorhaben, die früher Jahre dauerten, nun innerhalb von 2–3 Monaten genehmigt werden.
-
Planungssicherheit für Investoren: Durch verkürzte Verfahren steigen die Kalkulierbarkeit und Attraktivität von Bauprojekten wieder.
-
Stärkung der Gemeinden: Durch die Zustimmungsklausel wird die kommunale Planungshoheit nicht eingeschränkt, sondern in beschleunigter Form bekräftigt.
-
Wohnraumschaffung im Bestand: Der Bauturbo erlaubt flexible Nachverdichtung bestehender Gebiete, ohne förmliche Bebauungsplanverfahren.
Die Erwartung ist hoch: Die Bundesregierung hofft, bis 2030 eine erhebliche Menge an zusätzlichem Wohnraum zu schaffen – auch wenn das konkrete Ziel von 400.000 Wohnungen pro Jahr offiziell aufgegeben wurde.
Kritik und Risiken
So groß der politische Wille, so getrübt ist das Expertenvertrauen. Architektenkammern, Umweltverbände und Kommunalverbände äußerten früh Bedenken.
Die Bundesarchitektenkammer warnte in ihrer Stellungnahme, dass „eine pauschale Beschleunigung auf Kosten der baulichen Qualität und Umweltstandards“ gehen könne. Auch Fachkreise befürchten Planungschaos, wenn Gemeinden ohne ausreichende personelle Kapazitäten in kurzer Zeit viele Anträge prüfen müssen.
Zudem bleibt offen, wie weitreichend die Abweichungen vom Bauplanungsrecht tatsächlich sein dürfen, ohne Konflikte mit Landesrecht oder Nachbarschutz auszulösen. Befürchtet werden auch mehr Klageverfahren, falls Nachbarn ihre Beteiligungsrechte eingeschränkt sehen.
Kritiker betonen: Ohne ausreichend qualifiziertes Personal, transparente Standards und digitale Infrastruktur droht der „Bauturbo“ zum „Bau-Stau“ zu werden.
Reaktionen aus Politik und Wirtschaft zum Bau-Turbo
-
Bauministerin Verena Hubertz (SPD) sprach von „einem historischen Schritt“ und betonte, dass „Bauen wieder möglich werden muss, bevor der soziale Zusammenhalt bröckelt“.
-
Die CDU/CSU-Fraktion unterstützte das Gesetz grundsätzlich, kritisierte aber, dass die Finanzierung flankierender Maßnahmen – etwa für kommunale Planungsabteilungen – nicht mitgedacht wurde.
-
Die Grünen äußerten Bedenken hinsichtlich Umwelt- und Klimaschutzaspekten, insbesondere bei Ausnahmen vom Bebauungsplan.
-
Verbände der Bau- und Immobilienwirtschaft, wie der ZIA, begrüßten den Bauturbo als „ein dringend benötigtes Signal“ , fordern jedoch eine noch weitergehende Digitalisierung und bessere Abstimmung zwischen den Bundesländern.
Gesellschaftliche Bedeutung
Der Bauturbo ist mehr als ein bürokratisches Reformgesetz – er ist ein gesellschaftspolitisches Experiment. Seine Wirksamkeit wird sich daran messen lassen, ob Bürgerinnen und Bürger tatsächlich schneller Zugang zu bezahlbarem Wohnraum bekommen. Gleichzeitig steht das Gesetz für einen Paradigmenwechsel: weg von der Vollregulierung, hin zu einem Modell, in dem Vertrauen und Verantwortung an die Kommunen zurückgegeben werden.
Wenn die Umsetzung gelingt, könnte der Bauturbo zum Vorbild für weitere Beschleunigungsprogramme im Infrastrukturbereich werden – etwa beim Schul- oder Klinikbau.
Der neue § 246e BauGB ist zweifellos ein mutiger Schritt in der deutschen Wohnungspolitik. Er gibt Kommunen Werkzeuge an die Hand, um akute Engpässe schneller zu begegnen. Doch ob der Bauturbo tatsächlich „zündet“, hängt davon ab, wie entschlossen Städte und Gemeinden ihn anwenden – und ob Bund und Länder die versprochene digitale Infrastruktur und Personalunterstützung liefern.
Die nächsten Jahre bis 2030 werden zeigen, ob der Bauturbo die Wende bringt – oder nur ein weiteres Kapitel in der langen Geschichte deutscher Baugesetzgebungsreformen bleibt.
Der „Bauturbo“ ist ein Gesetzespaket zur Beschleunigung des Wohnungsbaus. Herzstück ist der neue Paragraph § 246e BauGB, der es Kommunen bis 2030 erlaubt, von bestimmten Bauvorschriften abzuweichen, um Wohnprojekte schneller zu genehmigen. Ziel ist es, Engpässe in Gebieten mit akutem Wohnungsmangel zu verringern und bürokratische Hürden abzubauen.
Mit der Zustimmung der Gemeinde können Bauvorhaben im Wohnungsbau künftig innerhalb von zwei bis drei Monaten genehmigt werden – statt wie bisher nach Jahren. Dabei entfallen manche Prüfverfahren, etwa zur Bauleitplanung, solange sie nicht zwingend für Umwelt- oder Denkmalschutz nötig sind.
Das Gesetz gilt ausschließlich für den Wohnungsbau in Regionen mit angespanntem Wohnungsmarkt (§ 201a BauGB). Dazu zählen Neubauten, Aufstockungen und Umnutzungen bestehender Gebäude zu Wohnzwecken. Großprojekte im Gewerbebau oder außerhalb bestehender Siedlungsflächen bleiben ausgeschlossen.
Die Regelung ist zeitlich befristet bis Ende 2030 und setzt auf freiwillige Anwendung durch Kommunen. Fachverbände wie die Bundesarchitektenkammer warnen jedoch, dass die Beschleunigung zu Qualitätsverlusten und Konflikten mit Umweltstandards führen könnte, wenn Planungsprozesse zu stark verkürzt werden.
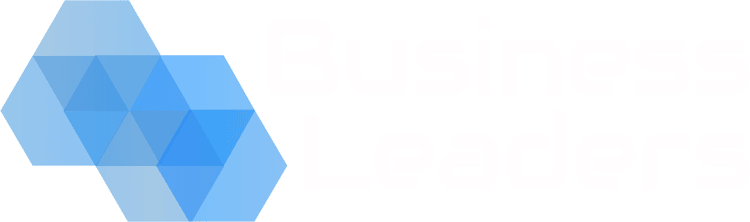

















Noch kein Kommentar vorhanden.