News

Die SPD befürwortet aktuell eine umfassende Digitalsteuer für große internationale Tech-Konzerne wie Google, Meta oder Amazon, die in Deutschland Milliardengewinne erzielen, aber nur sehr geringe Steuern zahlen. Der Vorschlag – mitinitiiert durch Kulturstaatsminister Wolfram Weimer, basiert auf einer bereits im Koalitionsvertrag verankerten Forderung der SPD. Ziel ist es, die „großen Fische der Internetkonzerne“ an den gesellschaftlichen Aufgaben zu beteiligen und gezielt in den Ausbau sowie die Stärkung des deutschen Medienstandorts zu investieren.
Die Digitalsteuer ist eine geplante Abgabe, mit der große internationale Internetkonzerne wie Google besteuert werden sollen, wenn sie in Europa Umsätze erzielen – selbst ohne klassische Niederlassung im Besteuerungsland. Ziel ist, das Steueraufkommen gerechter zu verteilen und Wettbewerbsverzerrungen zwischen globalen Plattformen und lokalen Unternehmen zu vermeiden.
Ziele der SPD-Digitalsteuer
-
Steuergerechtigkeit: Die großen Digitalkonzerne profitieren enorm vom deutschen und europäischen Markt, zahlen aber prozentual einen Bruchteil an Steuern im Vergleich zu heimischen Unternehmen. Hintergrund ist, dass diese Konzerne durch „aggressive Steuerplanung“ Gewinne so kleinrechnen, dass im jeweiligen Land kaum Steuern anfallen.
-
Gleiche Wettbewerbsbedingungen: Viele kleine und mittelständische Unternehmen fühlen sich benachteiligt, da sie in Deutschland höhere Steuersätze zahlen als internationale Digitalkonzerne. Die SPD fordert deshalb eine digitale Besteuerung, die Verzerrungen am Markt abmildern soll.
-
Finanzielle Spielräume schaffen: Die Einnahmen aus der Steuer oder Abgabe sollen – dem Modell einer „Plattformabgabe“ folgend – zweckgebunden dem Ausbau des Medienstandortes zugutekommen und innovative, unabhängige Plattformen fördern.
-
Maßnahme gegen Steuervermeidung: Anstatt einer Steuer auf Gewinne soll eine Steuer oder Abgabe direkt auf den Umsatz erhoben werden, damit sie nicht durch interne Verschiebungen umgangen werden kann. Als Anhaltspunkt wird das österreichische Modell genannt, das eine Digitalsteuer für Unternehmen mit weltweit mehr als 750Mio.€ Umsatz vorsieht.
Konkrete Ausgestaltung
-
Höhe: Diskutiert wird eine Abgabe von 10% auf Werbeeinnahmen großer Plattformen. Dies würde – laut Schätzungen aus der Politik – etwa 2,5Mrd.€ Steuereinnahmen pro Jahr bringen.
-
Betroffene Unternehmen: Die genauen Schwellenwerte müssen noch festgelegt werden. Maßgabe sind aber Plattformen, die weltweit hohe Umsätze und einen beträchtlichen Marktanteil in Deutschland haben, ähnlich wie beim österreichischen Modell.
-
Verwendung der Einnahmen: Während bei einer klassischen Steuer die Mittel im allgemeinen Haushalt landen würden, sieht der SPD-Vorschlag für eine Abgabe eine Zweckbindung vor – etwa zur Förderung von Medienvielfalt oder digitaler Infrastruktur.
Digitalsteuer – Kritik und Kontroverse
-
Wirtschaftlicher Widerstand: Wirtschaftsverbände wie Bitkom oder BVDW warnen vor negativen Effekten auf Innovation, Wettbewerb und Verbraucher. Sie argumentieren, die Steuer könne Kosten steigern, welche die Konzerne an Nutzer und Kunden weitergeben würden, und dadurch die Digitalisierung insgesamt ausbremsen.
-
Außenpolitische Bedenken: Insbesondere angesichts laufender Handelsverhandlungen zwischen EU und USA steht die Einführung einer nationalen Digitalsteuer unter Druck. Die US-Regierung hatte bereits mit Strafzöllen als Gegenmaßnahme gedroht, was die Bundesregierung dazu veranlasst, eine nationale Lösung nicht vorschnell umzusetzen. Auch innerhalb der Koalition gibt es Skepsis bezüglich des Timings und des Vorgehens ohne europäische Einigung.
-
Begrenzte Wirkung bei fehlender EU-Lösung: Experten und Politiker warnen, dass eine nationale Digitalsteuer leicht umgangen werden könne und letztlich eine internationale Koordination über EU oder OECD notwendig sei, um wirklich wirksam zu sein.
-
Offene technische Details: Noch ist nicht klar, ob es wirklich eine reine Steuer oder eine zweckgebundene Abgabe sein wird, und wie die Abgrenzung zu anderen Digitaldienstleistungen aussehen soll.
Die SPD positioniert sich klar für eine stärkere Besteuerung großer Digitalkonzerne durch eine Digitalsteuer oder Plattformabgabe und fordert zügige Fortschritte. Während die politische und öffentliche Debatte in Deutschland Fahrt aufnimmt, stehen dem Vorhaben sowohl wirtschaftliche als auch diplomatische und technische Hürden gegenüber. Ein nachhaltiger Erfolg scheint vor allem von einer europäischen oder sogar weltweiten Einigung abzuhängen
Internationale Diskussionen und Konflikte im Zusammenhang mit der Digitalsteuer drehen sich vor allem um folgende Aspekte:
-
Handelskonflikte zwischen USA und EU: Die USA lehnen nationale Digitalsteuern ab, da viele digitale Großkonzerne wie Google, Amazon oder Meta aus den USA stammen. Die US-Regierung droht deshalb mit Vergeltungszöllen und Sanktionen gegen Länder, die eine Digitalsteuer einführen. Dies verschärft die transatlantischen Spannungen im Wirtschafts- und Technologiepolitikbereich erheblich.
-
Uneinigkeit innerhalb Europas: Während Länder wie Frankreich, Österreich, Italien und Spanien eine Digitalsteuer eingeführt haben, sind andere EU-Staaten (zum Beispiel Irland, Dänemark, Schweden, Finnland) dagegen. Die EU-weite Einigung auf eine gemeinsame Digitalsteuergestaltung scheitert häufig an fehlender Einstimmigkeit. Das führt zu einer fragmentierten Steuerlandschaft und erschwert eine einheitliche internationale Steuerpolitik.
-
Gefahr von Doppelbesteuerung und Handelsstreitigkeiten: Nationale Digitalsteuern können zu Doppelbesteuerungen multinationaler Unternehmen führen, was rechtliche und wirtschaftliche Unsicherheiten schafft. Zudem befürchten viele Staaten, dass solche Alleingänge die Stabilität des internationalen Steuersystems gefährden und Handelskonflikte anheizen.
-
Notwendigkeit internationaler Koordination: Viele Experten und Staaten betonen, dass nur eine koordinierte, globale Lösung unter OECD oder EU das Problem der Gewinnverlagerung und Steuervermeidung durch digitale Geschäftsmodelle effektiv lösen kann. Unilaterale Maßnahmen werden oft als wenig effektiv und konfliktträchtig gesehen.
-
Wirtschaftliche und politische Forderungen: Die Digitalsteuer soll Steuergerechtigkeit herstellen, indem dort besteuert wird, wo Gewinne durch digitale Aktivitäten erzielt werden. Sie soll Wettbewerbsverzerrungen vermeiden und Steuerausfälle in traditionellen Steuersystemen minimieren. Gleichzeitig gibt es Bedenken, dass eine Digitalsteuer Innovationen hemmen und Konsumenten belasten könnte.
-
Politische Brisanz und Eskalationsrisiken: Die Debatte um die Digitalsteuer steht oft symbolisch für größere geopolitische und wirtschaftliche Machtkämpfe zwischen den USA, Europa und anderen Wirtschaftsmächten. Nationalstaatliche Vorstöße bergen das Risiko internationaler Eskalationen und erfordern sorgfältige Abstimmung und Diplomatie.
Zusammengefasst ist die Digitalsteuer ein komplexes Thema mit bedeutenden internationalen Spannungen, die sowohl wirtschaftliche, rechtliche als auch politische Dimensionen haben. Ihre Einführung nationaler Digitalsteuern wird oft als Auslöser weiterer Handelskonflikte gesehen, weshalb viele Akteure auf eine multilaterale Lösung drängen.
Die Debatte um die Digitalsteuer in der EU – insbesondere im Lichte aktueller Entwicklungen im Sommer 2025 – ist festgefahren und hochpolitisch. Eine journalistische Auswertung der genannten Quellen zeigt die Hintergründe, Ziele, Motive und Konfliktlinien aktueller Digitalsteuer-Initiativen im europäischen Kontext.
Aktueller Stand: Digitalsteuer vor dem Aus
Im Juli 2025 hat die EU-Kommission die Einführung einer Digitalsteuer für große internationale Tech-Konzerne faktisch auf Eis gelegt – zumindest in der geplanten Form einer europäischen „Eigenmittel“-Quelle für das Haushaltsbudget 2028–2034. Interne Dokumente zeigen, dass die Digitalsteuer im finalen Haushaltsentwurf nicht mehr enthalten ist; stattdessen sollen Abgaben auf Elektroschrott, Tabakprodukte und eine generelle Unternehmensteuer ab 50Millionen€ Jahresumsatz kommen. Der Hauptgrund: Politischer Druck und Handelsstreits mit den USA, insbesondere angesichts massiver Zollandrohungen der US-Regierung ab August 2025.
Das Ziel einer Digitalsteuer bleibt in Politik und Gesellschaft klar umrissen:
-
Steuergerechtigkeit: Multinationale Tech-Konzerne wie Alphabet, Meta oder Apple erzielen Milliardengewinne in Europa, zahlen aber durch Gewinnverlagerungen extrem wenig Steuern in den Mitgliedsländern.
-
Faire Wettbewerbsbedingungen: Nationale Unternehmen und Mittelstand fühlen sich gegenüber den digitalen Großkonzernen benachteiligt.
-
Schließung von Haushaltslücken: Momentan wird auch argumentiert, dass eine Digitalsteuer helfen könnte, die finanziellen Folgen der Corona-Hilfen zu finanzieren oder sinkende Einnahmen durch US-Zölle auszugleichen.
Politische und internationale Konfliktlinien
Die Digitalsteuer ist zu einem Symbol globaler Wirtschafts- und Machtkämpfe geworden: Die Einführung einer Digitalsteuer wird von US-Regierungen traditionell als gezielte Benachteiligung amerikanischer Unternehmen gewertet. US-Präsident Trump drohte im Sommer 2025 mit neuen Strafzöllen auf EU-Produkte (u.a. 30% auf viele EU-Exporte), sollte die EU an einer Digitalsteuer festhalten. In Kanada wurde die Idee einer eigenen Digitalsteuer nach US-Drohungen sogar ganz fallen gelassen.
Die EU-Kommission hat, um eine weitere Eskalation im Handelsstreit zu vermeiden, ihre Digitalsteuer-Vorschläge dem Vernehmen nach „verhandelt“ und die Steuer im aktuellen Haushaltsvorschlag gestrichen. Viele Beobachter sehen darin eine Unterordnung unter US-Interessen.
Europäische Uneinigkeit
Die Digitalsteuer scheitert regelmäßig im EU-Rat an Ländern wie Irland oder Schweden, die Digitalunternehmen steuerlich begünstigen. Schon bei den letzten Anläufen 2018/19 war der EU-Konsens am Veto einzelner Staaten zerbrochen. Statt einer Digitalsteuer gibt es eine neue Unternehmensabgabe für alle Unternehmen ab 50Millionen€ Umsatz, die jedoch nicht auf das Digitalgeschäft zielt und noch nicht konkret ausgestaltet ist.
Einige Mitgliedstaaten (z.B. Frankreich, Österreich, Spanien, Italien) haben bereits eigene Digitalsteuern eingeführt und generieren daraus Einnahmen (Frankreich: zuletzt rund 800Mio.€/Jahr).
Position der SPD und nationale Diskussion
Die SPD drängt weiter – auch als Reaktion auf den Rückzieher der EU – auf eine nationale Digitalsteuer, die als „Plattformabgabe“ gezielt Konzerne wie Google, Meta und Amazon besteuern soll. Der Vorstoß wird teils als Signal an die USA, teils als Versuch gesehen, innerhalb der EU Verhandlungsspielräume durch nationales Handeln zu erweitern. SPD-Vertreter argumentieren, dies könne auch einen Ausgleich für benachteiligende Zölle aus den USA schaffen. Allerdings ist die Koalition in der Frage zerstritten, die Union lehnt nationale Alleingänge strikt ab.
Kritik und Risiken
-
Gefahr für Verbraucher und Mittelstand: Ökonomische Fachbeiträge warnen, dass Digitalsteuern die Kosten für Plattformen oft an Händler und Verbraucher weitergegeben werden, was zu höheren Preisen für Endkunden führt. Besonders bei der Besteuerung von Umsätzen auf Marktplätzen wie Amazon besteht die Gefahr, dass am Ende auch lokale Anbieter und deren Kunden in der EU betroffen sind.
-
Abschreckung für Investitionen/Innovation: Kritiker sehen die Gefahr, dass eine Digitalsteuer die Attraktivität des Standorts EU für internationale Tech-Firmen mindert.
-
Polyzentralität/Fragmentierung: Unterschiedliche nationale Digitalsteuern führen zu regulatorischem Flickenteppich und könnten den EU-Binnenmarkt fragmentieren. Während manche Politiker dies gezielt als „Druckmittel“ nutzen wollen (das „Horrorszenario“ für die Tech-Konzerne), fürchtet ein anderer Teil der Politik (insbesondere CDU/EVP), so werde der Markt zersplittert und der Handelskrieg mit den USA angeheizt.
-
Verhandlungsmasse statt Steuerpolitik: Die Digitalsteuer wird – so die Kritik etwa von NGO-Vertretern und Grünen – am Ende eher als politische Verhandlungsmasse im transatlantischen Handelsstreit missbraucht und weniger als Instrument für Steuergerechtigkeit verstanden.
Die EU-Digitalsteuer ist 2025 erneut an geopolitischen, europäischen und wirtschaftlichen Konflikten gescheitert. Sie bleibt politisch umstritten, ökonomisch ambivalent und international hochbrisant. Der Handlungsdruck bleibt bestehen: Ohne Einigung drohen nationale Alleingänge und weitere Handelskonflikte mit den USA; mit Einigung können jedoch zentrale Ziele der Steuergerechtigkeit und Haushaltskonsolidierung erreicht werden – sofern die Risiken für Wirtschaft und Verbraucher bedacht werden.
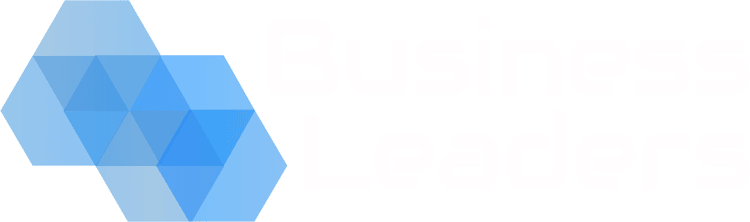



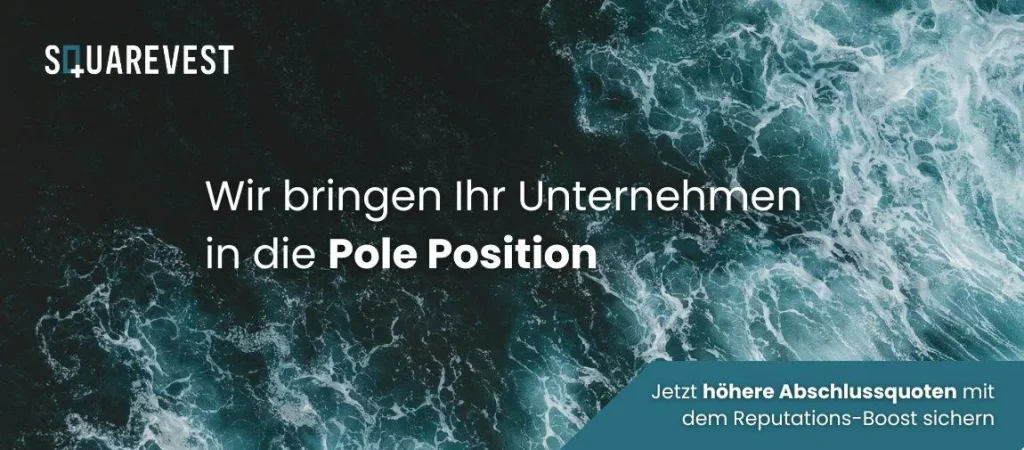


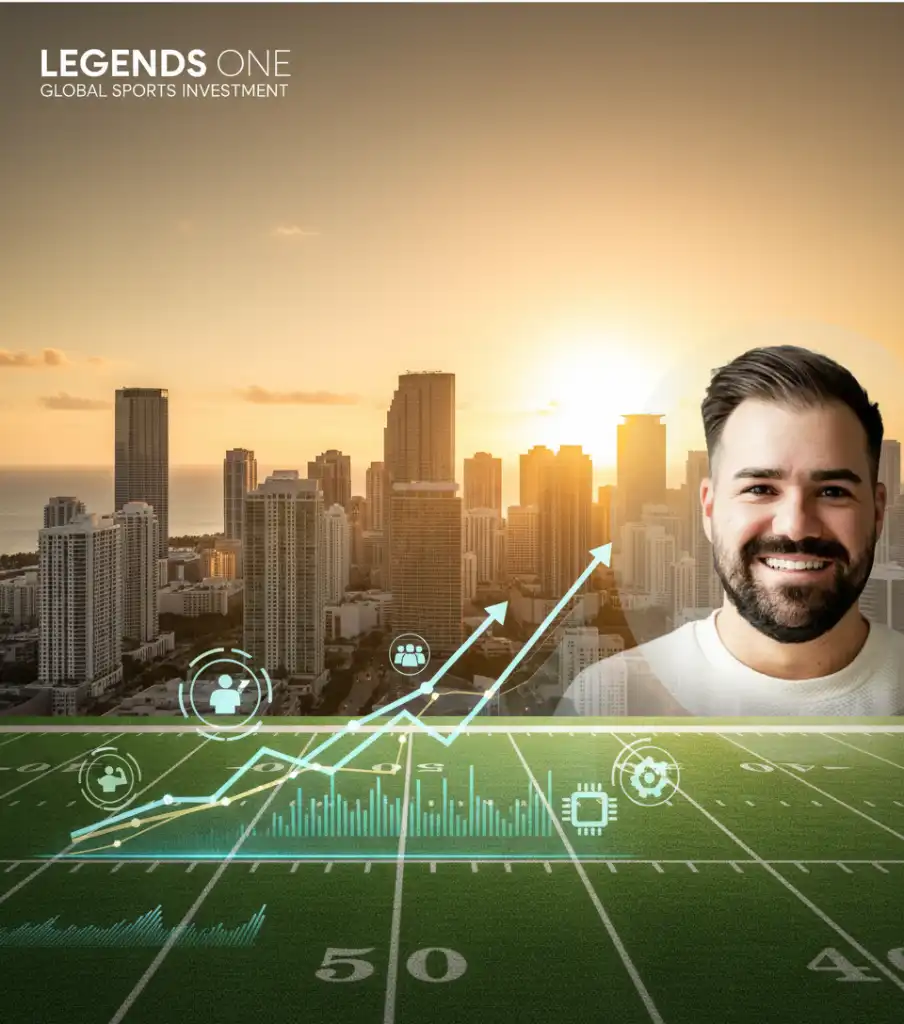










Noch kein Kommentar vorhanden.