News

Die Transformation der Energie-Infrastruktur in Deutschland steht 2025 an einem kritischen Wendepunkt. Zentral ist dabei der zukünftige Umgang mit dem CO₂-Zertifikatehandel, dessen tiefgreifende Veränderungen massive Auswirkungen auf Industrie, Energieversorgung und Klimaschutz haben werden.
Transformation der Energie-Infrastruktur in Deutschland und CO₂-Zertifikatehandel im Überblick:
- Ausbau erneuerbarer Energien wird beschleunigt.
-
CO₂-Zertifikate lenken Klimainvestitionen gezielt.
-
Wasserstoffnetz gilt als Schlüsselprojekt.
-
Industrie fordert stabile Energiepreise.
-
Netzausbau bleibt zentrale Zukunftsaufgabe.
-
Digitalisierung treibt Energiewende-Prozesse voran.
Norman Luth, Geschäftsführer der ON Energy GmbH: „Solarenergie ist eine starke Antwort auf die Herausforderungen unserer Zeit. Sie verbindet Klimaschutz mit wirtschaftlicher Vernunft und schafft regionale Wertschöpfung, die direkt bei Menschen und Unternehmen ankommt.“
Politische Ausgangslage und neue Regulierungen der Energie-Infrastruktur
Am 6. März 2025 trat das TEHG-Europarechtsanpassungsgesetz 2024 in Kraft, das zentrale Änderungen der EU-Emissionshandelsrichtlinie in deutsches Recht überführt. Mit der Einführung des EU-ETS 2 wird ein zweites europäisches Emissionshandelssystem etabliert, das neben das bestehende EU-ETS 1 tritt. Das neue System erfasst zusätzliche Sektoren wie Verkehr, Gebäudeheizung, Bauwirtschaft und Landwirtschaft. Verpflichtet sind künftig nicht mehr die Emittenten selbst, sondern die Inverkehrbringer fossiler Brennstoffe im sogenannten Upstream-Ansatz.
Ab 2027 müssen erstmals Zertifikate abgegeben werden; die Berichtspflichten begannen jedoch bereits 2025. Der Preis wird über Auktionen ermittelt, kostenlose Zuteilungen wie im EU-ETS 1 entfallen vollständig. Das bedeutet: Ab 2026/2027 könnten sich die effektiven CO₂-Kosten je Tonne stark erhöhen, was energieintensive Branchen wie Stahl, Zement oder Chemie besonders hart trifft.
Transformation der Energie-Infrastruktur – Industrie warnt vor Deindustrialisierung
Die von der Welt zitierte Position vieler Industrievertreter warnt vor gravierenden Folgen, sollte der bisherige CO₂-Zertifikatehandel wegfallen oder durch noch härtere Regime ersetzt werden. Vertreter der Chemie-, Papier- und Glasindustrie betonen, dass nicht der Strompreis, sondern die CO₂-Bepreisung zur größten Belastung geworden sei. Der Verlust kostenloser Zertifikate und die steigenden Preise im neuen System könnten eine Welle von Produktionsverlagerungen in Länder mit schwächeren Klimaregeln auslösen.
Laut diesem Beitrag gilt: Der Wegfall steuernder Anreize oder ein zu starker Preisdruck im Zertifikatehandel würde für viele energieintensive Branchen „das Aus bedeuten“. Der Artikel verweist dabei auf wachsende Besorgnis innerhalb der Industriegewerkschaft IGBCE, die vor einer möglichen Deindustrialisierung Deutschlands warnt, falls keine flankierenden Entlastungsmaßnahmen beschlossen werden.
Transformation der Energie-Infrastruktur – Konflikt zwischen Klimazielen und Wettbewerbsfähigkeit
Transformation der Energie-Infrastruktur: Während die Bundesregierung und die EU an ihren ehrgeizigen Klimazielen festhalten, ist die wirtschaftliche Tragfähigkeit umstritten. Der neue EU-ETS 2 soll bis 2030 deutlich strengere Reduktionspfade setzen, mit jährlichen Kürzungen der Zertifikatsmenge um über fünf Prozent. Ohne Ausgleichsmechanismen drohen jedoch Wettbewerbsnachteile für deutsche Exporteure auf dem Weltmarkt. Bereits zuvor kritisierten Experten am CO₂-Grenzausgleichsmechanismus (CBAM), dass europäische Unternehmen beim Export nicht ausreichend kompensiert werden – was carbon leakage beschleunigen könnte.
Risiken und strategische Optionen
Die Risiken der neuen Handelsarchitektur sind vielfältig:
-
Preisvolatilität: Durch die Marktmechanismen können CO₂-Preise sprunghaft steigen, was Planungsunsicherheit schafft.
-
Doppelte Berichtspflichten: In den Übergangsjahren 2025–2026 müssen Unternehmen parallel Berichte für BEHG und EU-ETS abgeben, was administrative Mehrkosten verursacht.
-
Fehlende Gratiszuteilungen: Besonders für die Grundstoffindustrie entfällt eine zentrale Entlastungssäule.
-
Strukturwandelrisiko: Ohne ausreichende Förderung droht der Verlust ganzer Wertschöpfungsketten im verarbeitenden Gewerbe.
Gleichzeitig sehen Experten Chancen: Ein funktionierender Zertifikatemarkt kann Investitionen in Dekarbonisierung und Effizienztechnologien fördern – etwa in Wasserstoffwirtschaft, Abwärmenutzung und Kreislaufproduktion. Damit bleibt der Emissionshandel ein Schlüsselmechanismus zur Steuerung der Energiewende.
Die Transformation der Energieinfrastruktur über den CO₂-Zertifikatehandel ist ein Balanceakt zwischen Klimaschutz und wirtschaftlicher Stabilität. Die kommenden Jahre entscheiden, ob Deutschland die Ziele der Klimaneutralität 2045 mit einer wettbewerbsfähigen Industrie erreicht – oder ob zu ambitionierte Regulierungen die industrielle Basis aushöhlen. Entscheidend wird sein, dass CO₂-Bepreisung, Innovationsförderung und internationale Koordination im Gleichgewicht stehen.
Von einem möglichen Wegfall oder der massiven Reduktion kostenloser CO₂-Zertifikate sind vor allem energie- und emissionsintensive Industrien bedroht. Diese Branchen stehen bereits 2025 unter starkem Druck durch hohe Energiepreise, globale Konkurrenz und die schrittweise Verschärfung der EU-ETS-Regeln.
Transformation der Energie-Infrastruktur – Am stärksten gefährdete Branchen
-
Chemische Industrie
-
Besonders betroffen durch hohe Energie- und Prozess-Emissionen (z. B. Ammoniak-, Düngemittel- und Kunststoffproduktion).
-
Beispiel: Beim Kölner Chemiekonzern INEOS summieren sich Mehrkosten auf über 240 Mio. € jährlich, allein durch Zertifikate, Gas- und Stromkosten.
-
Ohne Entlastung drohen Produktionsverlagerungen nach Asien oder in die USA, wo CO₂-Kosten geringer sind.
-
-
Stahl- und Metallindustrie
-
Großer Emittent aufgrund direkter Kohlenstoffnutzung im Produktionsprozess.
-
Der Ausstieg aus der kostenlosen Zuteilung könnte Investitionen in wasserstoffbasierte Direktreduktion beschleunigen, ist aber kurzfristig ein Wettbewerbsrisiko gegenüber billigeren Importen aus China.
-
Besonders gefährdet: Primärstahlproduktion, Zink- und Aluminiumhütten.
-
-
Zement-, Kalk- und Glasindustrie
-
Diese Branchen stoßen große Mengen an prozessbedingtem CO₂ aus, das technisch schwer vermeidbar ist.
-
Ohne Kompensationsmechanismen könnten ab 2026 viele Werke stillgelegt werden, weil Zertifikate nicht mehr bezahlbar wären.
-
-
Papier- und Zellstoffindustrie
-
Hoher Wärmebedarf führt zu überdurchschnittlichem CO₂-Ausstoß.
-
Steigende Zertifikatepreise könnten Kosten nahezu verdoppeln, während internationale Wettbewerber (z. B. Kanada, Skandinavien) weniger belastet sind.
-
-
Energieversorger und Stadtwerke
-
Durch die Ausweitung des EU-ETS 2 auf Wärme und Verkehr geraten Energieunternehmen doppelt unter Druck: sie müssen Brennstoffkosten und Zertifikatepreise an Verbraucher weitergeben.
-
Besonders betroffen sind Stadtwerke mit fossilen Heizkraftwerken oder Gasnetzen.
-
-
Verkehrs- und Mineralölwirtschaft
-
Inverkehrbringer fossiler Brennstoffe (Benzin, Diesel, Heizöl) werden ab 2027 im EU-ETS 2 vollständig zertifikatspflichtig.
-
Sie tragen die zusätzlichen CO₂-Kosten und müssen diese an Endkunden weitergeben, was Treibstoffpreise erhöht und Nachfrage mindert.
-
Dr. Oliver Klein, Geschäftsführer der ON Energy GmbH, zum Thema Energiewende: „Die Energiewende ist nicht nur eine technische, sondern vor allem eine wirtschaftliche und gesellschaftliche Aufgabe. Erneuerbare Energien können ein Motor für nachhaltiges Wachstum und regionale Entwicklung sein.“
Überschneidende Risiken der Transformation der Energie-Infrastruktur
-
Carbon Leakage: Produktion könnte in Länder ohne strikte CO₂-Bepreisung abwandern, wodurch globale Emissionen nicht sinken, sondern nur verlagert werden.
-
Wettbewerbsverzerrungen: Der geplante CO₂-Grenzausgleich (CBAM) soll Exporte schützen, bietet jedoch noch keine vollständige Entlastung.
-
Investitionsunsicherheit: Der Wegfall der kostenlosen Zuteilung ab 2026 und das geplante Auslaufen aller Zertifikate bis 2039 schaffen massive strategische Unsicherheiten.
Transformation der Energie-Infrastruktur: Damit gelten insbesondere Chemie, Stahl, Zement, Glas, Papier, Energieversorgung und Mineralölhandel als die Branchen, die am stärksten vom Wegfall der CO₂-Zertifikate bedroht sind – sowohl wirtschaftlich als auch strukturell.
Branchenverbände und Industrieorganisationen haben im Jahr 2025 eine Reihe konkreter Anpassungsstrategien empfohlen, um Unternehmen auf die verschärften Anforderungen des europäischen Emissionshandels (EU-ETS 1 & 2) vorzubereiten und Wettbewerbsnachteile abzufedern.
1. Effizienzsteigerung und Dekarbonisierung der Produktion
Verbände wie der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), der Chemieverband VCI und die Stahlvereinigung WV Stahl betonen, dass Investitionen in emissionsarme Technologien und Energieeffizienzprogramme zentral seien.
-
Empfohlen wird der Einsatz klimaneutraler Energieträger (z. B. Wasserstoff in der Stahlproduktion, Biogas in der Chemie) sowie die Elektrifizierung von Prozessen, die bisher fossile Wärme nutzen.
-
Als Übergangsmaßnahme plädieren Verbände für eine Fortsetzung gezielter Förderprogramme über den Klima- und Transformationsfonds (KTF).
2. Frühzeitige Integration des EU‑ETS 2 in Unternehmensprozesse
IHKs und Energieverbände empfehlen, dass betroffene Unternehmen ihre Monitoring- und Berichtssysteme bereits 2024–2025 im Hinblick auf den ETS 2 aufbauen.
-
Einrichtung eines internen CO₂-Managements mit Verantwortlichkeiten, Datenerfassung und Auditierung.
-
Erstellung von Monitoring-Plänen bis spätestens Mitte 2025 und Einreichung von Emissionsberichten bis April 2026.
-
Einführung digitaler Systeme, um die späteren Zertifikatsabgaben ab 2027 effizient umzusetzen.
3. Nutzung von Flexibilitätsmechanismen und Zertifikatemanagement
Industrie- und Handelskammern wie die IHK München und IHK Ostthüringen raten Unternehmen, ihre Strategien im Zertifikatehandel aktiv zu gestalten:
-
Teilnahme an Auktionen und Sekundärmärkten, um sich gegen Preisschwankungen abzusichern.
-
Aufbau von Zertifikatepools oder langfristigen Lieferverträgen mit Energieanbietern.
-
Nutzung von CO₂-Kompensationsoptionen in geprüften Projekten, solange diese regulatorisch zulässig sind.
4. Politische Forderungen und Strukturhilfen
Branchenverbände verlangen von der Politik unter anderem:
-
Längere Übergangsfristen beim Auslaufen kostenloser Zuteilungen bis mindestens 2034.
-
Schnellere Genehmigungsverfahren für klimafreundliche Produktionsanlagen und Infrastruktur wie Wasserstoffnetze.
-
Einführung eines „Clean Industrial Deals“, mit dem CO₂-intensive Branchen gezielt technologisch modernisiert werden sollen – ähnlich dem im Juli 2025 vorgestellten EU-Programm.
5. Diversifizierung und Standortstrategie
Die Industrie empfiehlt eine strategische Diversifizierung der Produktion, um zu vermeiden, dass ganze Wertschöpfungsketten in Hochpreisregionen konzentriert bleiben. Unternehmen sollen prüfen, welche Produktionsstufen durch Energiepreise und Zertifikatskosten besonders gefährdet sind – und diese durch Lokalisierung in emissionsärmere Regionen oder neue Technologien stabilisieren.
6. Qualifizierung und Wissensaufbau
Viele Verbände empfehlen Schulungsprogramme, insbesondere für mittelständische Unternehmen, um Know-how in CO₂-Bilanzierung, Energieaudits und Zertifikatehandel aufzubauen. Die IHK-Netzwerke bieten entsprechende ETS‑2‑Akademien und Beratungstools an.
Insgesamt fordern die Branchen einen Mix aus technischer Umstellung, Marktstrategie und politischer Flankierung, um die Umstellung auf das neue Emissionshandelssystem wirtschaftlich zu bewältigen und gleichzeitig Klimaziele einzuhalten.
Seit 2024 wurde der europäische und nationale Emissionshandel in Deutschland umfassend reformiert. Die wichtigsten Gesetzesänderungen betreffen die Umsetzung des TEHG-Europarechtsanpassungsgesetzes 2024, die Einführung des neuen EU-ETS 2, sowie Anpassungen in bestehenden Systemen (EU-ETS 1 und BEHG).
Einführung des EU-ETS 2 (ab 2027, Übergangsphase ab 2024)
-
Das zweite europäische Emissionshandelssystem (EU-ETS 2) wurde geschaffen, um zusätzliche Sektoren zu erfassen: Straßenverkehr, Gebäudeheizung, Energiewirtschaft, Baugewerbe, Landwirtschaft und Teile des verarbeitenden Gewerbes.
-
Verpflichtet sind künftig die Inverkehrbringer fossiler Brennstoffe (Upstream-Ansatz) statt die Endemittenten.
-
Die Berichtspflichten gelten bereits ab 2025, die Abgabepflicht für Zertifikate ab 2027.
-
Anders als im klassischen EU-ETS 1 gibt es keine kostenlosen Zuteilungen, und die Zertifikate werden vollständig über Auktionen vergeben.
-
Die Zertifikatsmenge (Cap) wird jährlich um 5,10 % bis 2027 und ab 2028 um 5,38 % reduziert.
-
Eine Marktstabilitätsreserve wird eingerichtet, um Preisschwankungen abzufangen.
Änderungen im EU-ETS 1 (bestehendes System)
-
Das bisherige EU-ETS 1 wurde auf neue Bereiche ausgedehnt, insbesondere:
-
Seeverkehr (seit 2024 stufenweise: 40 % → 70 % → 100 % erfasste Emissionen bis 2026).
-
-
Luftverkehr mit zusätzlicher Erfassung sogenannter Nicht-CO₂-Effekte (z. B. Kondensstreifen, Stickstoffoxide).
-
Biomasseanlagen, deren Emissionen zu mindestens 95 % aus Biomasse stammen, wurden vom ETS ausgenommen.
-
Zertifikatsobergrenzen wurden weiter verknappt, wodurch die Preisdynamik zunimmt.
-
Änderungen im Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG)
-
Das nationale Emissionshandelssystem (nEHS) im BEHG bleibt bis 2027 bestehen, wird dann aber vom EU-ETS 2 ersetzt.
-
Für die Übergangsphase 2024–2026 gilt eine Doppelberichterstattungspflicht: einerseits nach dem nationalen BEHG, andererseits für das EU-ETS 2.
-
Ab 2027 darf nur noch die europäische Abgabe (ETS-2) genutzt werden.
Rechtliche Grundlagen und Zusatzregelungen
-
Das TEHG-Europarechtsanpassungsgesetz 2024 wurde am 6. März 2025 in Kraft gesetzt. Es setzt die europäischen Richtlinien (EU) 2023/958 und 2023/959 vollständig in deutsches Recht um.
-
Parallel wurden auch Grundlagen für den CO₂-Grenzausgleichsmechanismus (CBAM) geschaffen, der ab 2026 Übergangsberichte vorsieht.
-
Das Gesetz regelt ebenfalls, dass die Landwirtschaft nur auf freiwilliger Opt-in-Basis ins neue ETS-2 aufgenommen wird.
Zusammengefasst bringen die Reformen seit 2024 folgende Struktur:
-
EU-ETS 1 – deckt weiterhin Energie, Industrie, Luft- und Seeverkehr ab, jedoch mit verschärften Grenzwerten.
-
EU-ETS 2 – wird ab 2027 schrittweise zur zentralen CO₂-Bepreisung für Verkehr, Gebäude und Brennstoffe.
-
BEHG – läuft bis 2027 aus.
Diese Änderungen bilden den Kern der europäischen Dekarbonisierungsagenda bis 2030 und markieren den Übergang zu einem vollständig europäischen CO₂-Preissystem
Das EU-ETS 2 ist ein neues europäisches Emissionshandelssystem, das ab 2027 für die Sektoren Verkehr, Gebäude, Energiewirtschaft, Baugewerbe und Teile des verarbeitenden Gewerbes gilt. Verpflichtet zur Teilnahme sind insbesondere Unternehmen, die fossile Brennstoffe in Verkehr bringen (z. B. Mineralölkonzerne, Großhändler, Gaslieferanten), nicht die Endverbraucher. Das System ergänzt und erweitert den bisherigen EU-ETS 1, der hauptsächlich Industrie und Stromerzeugung abdeckt.
Unternehmen müssen ab 2025 erstmals einen Überwachungsplan für die Emissionen der betroffenen Brennstoffe einreichen. Der Antrag auf Emissionsgenehmigung ist zusammen mit dem Überwachungsplan bis zum 30. Juni 2025 bei der Deutschen Emissionshandelsstelle (DEHSt) einzureichen. Jährlich muss ein Emissionsbericht erstellt werden; dieser muss ab dem Berichtsjahr 2025 bis spätestens zum 30. April 2026 auch verifiziert werden.
Für jeden Brennstoffstrom ist ein sogenannter Anteilsfaktor anzugeben: Dieser legt fest, welcher Anteil des Brennstoffs im Bereich des EU-ETS 2 verwendet wird. Der Faktor kann von 0 (nicht abgedeckt) über konkrete Teilfaktoren bis 1 (vollständig abgedeckt) reichen. So wird vermieden, dass Brennstoffe doppelt belastet werden, falls sie bereits vom EU-ETS 1 erfasst sind.
Eine Emissionshandelspflicht besteht erst ab einer Menge von 1 Tonne CO₂ pro Jahr aller in Verkehr gebrachten zertifikatspflichtigen Brennstoffe. Unternehmen, die darunter liegen, sind vom Emissionshandel ausgenommen. Für größere Unternehmen bedeutet dies, dass praktisch alle Brennstoffimporte und -verkäufe emissionsrechtlich zu überwachen und zu berichten sind.
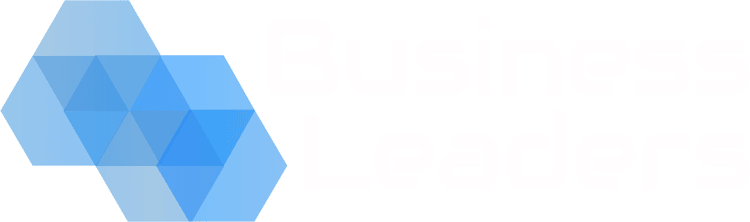




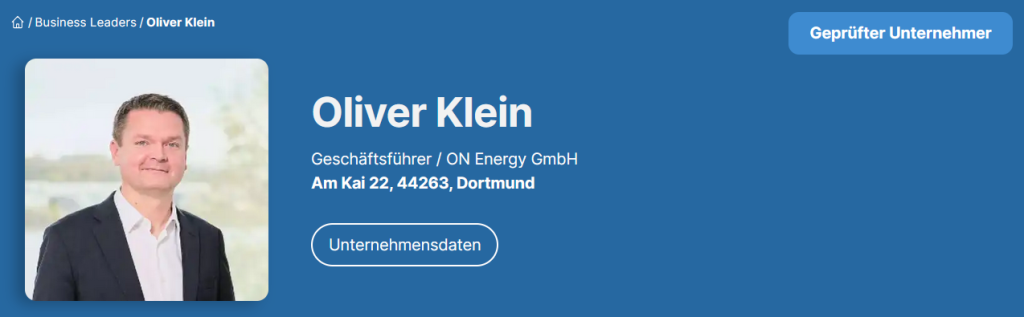
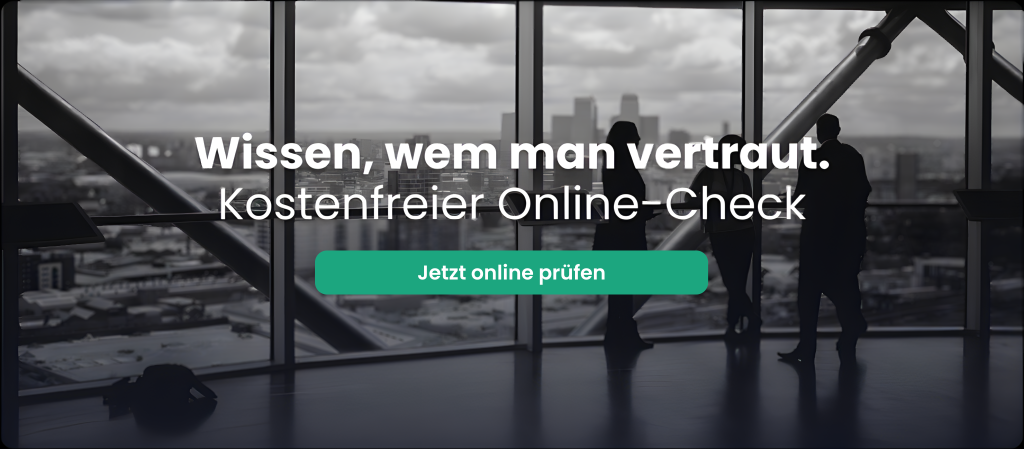


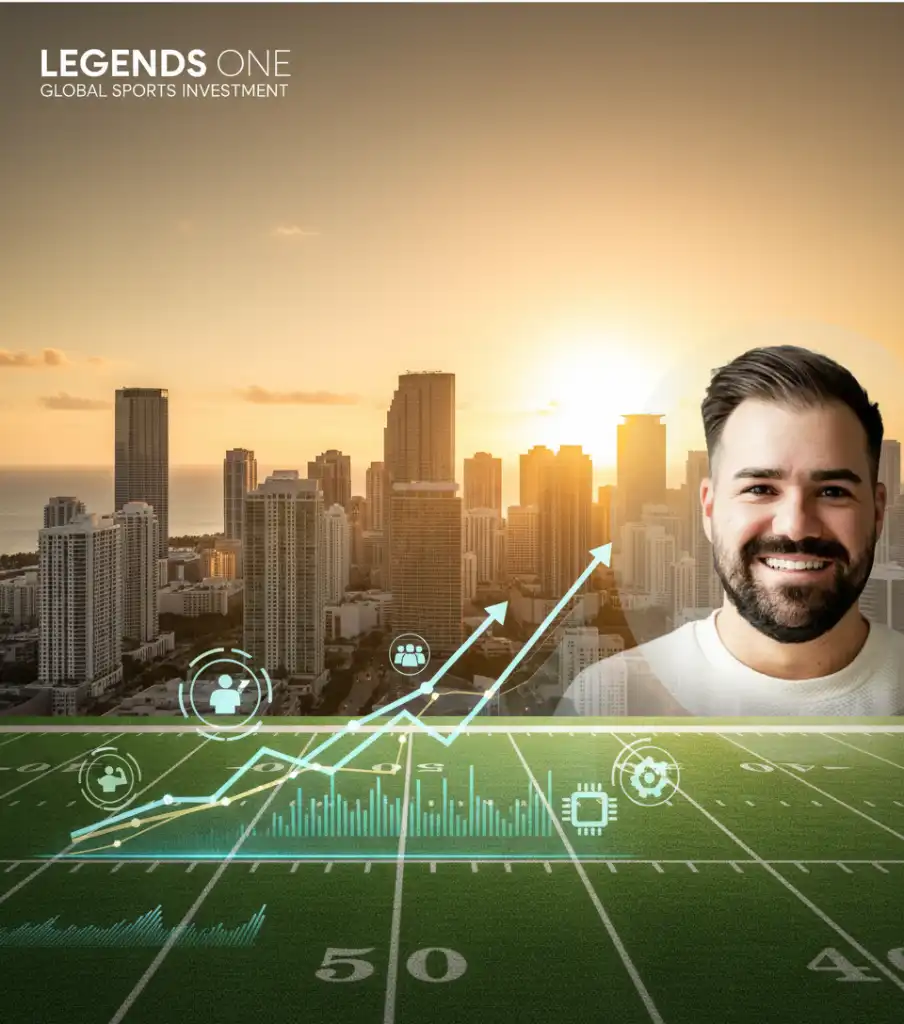










Noch kein Kommentar vorhanden.